
Von TIMO FELDHAUS
Ganz am Rande der Eröffnung, ganz am Rande der ganzen rumstehenden Menschen, lehnt in zarter Gewaltigkeit an der Wand aufgerichtet der riesenlange Körper eines jungen Mannes. Er bewegt sich langsam in die Mitte des Ausstellungsraumes, grüßt dabei wahllos ein paar Leute, und Recht hat er, es sind ja wirklich alle da. Dann hüpft der große Mensch, der kaum Englisch spricht, plötzlich auf der Stelle und schreit laut: »Eins ist doch wohl klar: Es ist nicht mehr 1993!« Offene Münder, verständiges Nicken, unbehagliche Gefühle – Reena Spaulings in der Galerie Neu. Die New Yorker Trendforscherin Emily Segal kommt auf mich zu, wir reden ein bisschen über die neue Cola-Werbung und über die geniale Widersprüchlichkeit des Jonah Peretti, den Erfinder des Celebrity-Portals BuzzFeed und der Huffington Post. Meine Freundin versucht mit einer Grafikerin ein Redesign ihres tumblr-Blogs direkt am Handy. Auf einem weißen Zettel im Ausstellungsraum steht geschrieben: »Because everything has already been subjected to a process of problematization, critical ambitions in their original appearance don’t seem fruitful anymore.«
Wir steigen auf unsere Rennräder und fahren nach Mitte in die Bar Pauly Saal. Der Garten wird eingeweiht, riesige Libellen schwirren über uns, die abc-Direktorin Maike Cruse wandelt anmutig zwischen den Gästen umher, der Schriftsteller Rafael Horzon, der seit Jahren erfolgreich ein ironisches Bücherregal an die Bewohner Berlin Mittes verkauft, gibt mir zwei Gläser Weißwein, und da erscheint es auf seinem Gesicht: das berühmte Grinsen des Möbelbauers. Ich gehe zu Dominic Eichler. Er ist lieb. Wir streichen uns sacht über den Haaransatz im Nacken und reden über Paul Bowles Biografien und ob Kraftwerk oder Tschaikowski besser ist und wer den Soundtrack zu Peter und der Wolf geschrieben hat. Am Tisch sitzt ein Mann, er saugt an einer leeren goldenen Zigarettenspitze, seine Begleitung sagt zu ihm: »Du bist der Out-Cast of the out-cast der out-casts«. Es liegt ein seltsamer Zauber über der vorsichtig sanierten ehemaligen Jüdischen Mädchenschule in der Auguststraße. Alles scheint so gut vorbereitet und gelungen. Über uns thront der Sammler in seinen ausgebauten Gemächern, zwischen publikumsstarken Galerien ein hervorragendes Bistro mit jüdischer Deli-Tradition, am Ausgang wurden vor vielen Jahren Kinder von Nazi-Schergen aus dem Gebäude getrieben und deportiert.

Am nächsten Morgen stehe ich ganz früh am Rand des mittleren Beckens des Kreuzberger Prinzenbads. Ich sehe Mädchen in glänzenden Burkinis von Speedo, manche tragen gar raffinierte Tribals in Neonfarben auf ihrem Kunstfaserganzkörperbadekostüm. Daneben alte, deutsche Männer fast schon dunkelschwarzroter Farbe. Sie sind jeden Tag hier, aber würden niemals ins Wasser steigen. Ich fühle mich wie die Kreuzung von beiden Menschentypen, stürze mich ins Nass, tauche wieder auf, neugeboren. Am Abend besuche ich Yngve Holen in seinem Studio in einem Sozialbau-Hochhaus über dem Kottbusser Damm. Wir googlen bei Stiftung Warentest die besten Fahrradschlösser der Welt, hören Yeezus von Kanye West und unterhalten uns über Flugzeuge. Ich zeige ihm die kurzen Filme, die ich mit einer in einer Brille eingebauten versteckten Kamera an Bord eines Airbus A380 für ihn gemacht habe. Später sitzen wir unten am Bordstein, alle Flanierenden haben funkelnde, minimalistische Rennräder dabei, es werden Drogengeschäfte abgewickelt, Leute beißen in Südfrüchte, der Saft läuft ihnen herunter, sie trinken viele Biere. Wir auch. Wir warten auf den kleinen Gypsy-Jungen mit dem silbernen Cappy, der so unglaublich toll tanzen kann. Er kommt auch, aber nur in der Gruppe mit den anderen, sie streiten um Süßigkeiten, keiner tanzt.




Molekularküche

reading Gilles Deleuze.


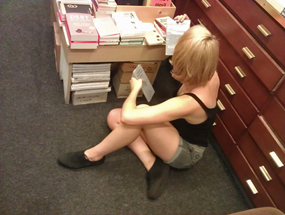

Am nächsten Tag gibt es eine Präsentation im Zine-Laden Motto, Starship feiern ihre Publikation über die vor drei Jahren verstorbene Annette Wehrmann, die Aktivistin T-Ina und Judith Hopf lesen Texte vor, die Wehrmann Ende der 80er auf einer neuartigen Schreibmaschine auf Luftschlangen getippt hat. Ich schaue mir in einem Magazin das Porträt der Wohnung von Michael Stipe an, auf praktisch allen Covern im Laden ist Chloë Sevigny platziert. Auf dem Weg hinaus sehe ich vor der Galerie Silberkuppe einen runden Tisch aufgebaut, um den allerlei gut gelaunte Menschen sitzen. Es ist der Geburtstag von Danh Vo. Karl Holmqvist murmelt etwas und lächelt exakt genau so schelmisch wie Rafael Horzon, sie sind vom selben Schlag. Die Musikerin Arises erzählt von Nürnberg, sie komponiere dort die Hymne für eine Bibliothek. Ich erzähle von der Frau, die sich bei der Meret Oppenheim Eröffnung im Martin-Gropius-Bau die berühmte Pelztasse als Nachbau ins Haar gesteckt und dass mir das wirklich gefallen hat. Ihre Begleitung findet, dass unsere Gegenwart so verdichtet ist, zur gleichen Zeit angefüllt mit einer Art von Beschleunigung und einer Art der Verlangsamung, sodass es schwierig ist, die Vergangenheit von der Gegenwart noch unterscheiden zu können, und womöglich könne man auch überhaupt nicht mehr von Gegenwart sprechen. Ich finde das sehr philosophisch. Später schmettert ein Sänger ganz laut eine Arie aus Rheingold. Wir gehen weiter. Es wird Tag, es wir Nacht, es hat immer noch nicht geregnet, wir lachen uns ins Gesicht.



»Wem gehört die Stadt?« Die Frage kommt mir peinlich vor, sie wirkt so riesig, als würde sie den Raum und den Inhalt aller in dieser Stadt lebenden Köpfe weit überragen, ja eigentlich, als wollte sie ihre Köpfe seit Jahren spalten. Ich schaue ins Internet und sehe, dass die Diskussionsveranstaltung mit diesem Titel im Kunstraum Kreuzberg gleich beginnt. Auf dem Weg halte ich an einem verlassenen Sportplatz inne. Nik Kosmas und Jeanne-Salomé Rochat machen dort Sex-Turnübungen. Sie sind direkt vom Chesters hierher und tun, was sie sonst dort an der Gogo-Stange machen. Ihre gestählten Körper sind wunderschön im Sonnenlicht, sie tragen Gesichts-Tattoos. Ich versuche zu erklären, wohin ich will. Sie verstehen nichts von dem, was ich rede, ich merke es. Es zieht sie zurück auf die rote Tartanbahn, der Blick auf ihre angehängten Body Analyser verrät es, tschüss sage ich und denke dass sie ganz sicher Recht haben, fahre nicht zur Stadtpolitik-Diskussion, sondern stattdessen ins nhow Design- und Rockhotel, wohin Nike zu einer Schuhpräsentation eingeladen hat. Wir bekommen dort einen Rucksack überreicht, in dem sich Joggingkleidung und die neuen Laufschuhe befinden, die die ultimative Flexibilität des Nike Free und die Kompressionspassform der Flyknit-Konstruktion, die sich wie eine zweite Haut anfühlt, zu einem noch natürlicheren Laufgefühl verbinden soll. Umgezogen sehen wir aus wie eine tolle Armee, ich trage einen atmungsaktiven Camo-Dri-FIT, wir laufen durch Kreuzberg, den Weg weist uns ein Fahrrad, auf das ein Hi-Fi-Endgerät geschnallt ist, aus dem »Work Hard, Play Hard« schallt. Eine SMS geht ein: »Von Borries ist vor dem Hamburger Bahnhof auf seine Berliner Weltverbesserungsmaschine gestiegen, sie hat die Form einer Pyramide : )«. Ich schmunzle, ein erster Schweißtropfen kullert mir über die Lippen, ein Punk hält mir seine Ratte entgegen und guckt böse, weil wir über seinen Bürgersteig laufen und Werbung machen, durch Laufen. Wir lachen ihn strahlend an, joggen in raffinierten Zirkeln an ihm vorbei, immer weiter und weiter bis zum Stadtrand, nach Treptow raus, wo die Townhouses stehen und die glücklichen Familien darin in Harmonie den Abend beschließen.
Am nächsten Morgen Pressekonferenz in der ehemaligen Kirche St. Agnes, die der Galerist Johann König von Arno Brandlhuber, dem aktuellsten aller Brutalismus-Architekten, umbauen und so lange zwischennutzen lässt. Aktuell von Friedrich von Borries, Designtheoretiker, Hochschullehrer, Sneakerfreaker. Gestern noch am Hamburger Bahnhof, heute Buchvorstellung »RLF«, das richtige Leben im Falschen ist möglich, Adorno wird umgewendet. Sein Buch kommt mit Produktlinie, deren Konsum in einen revolutionären Akt überführt werden soll. In der Mitte der Kirche steht auf einer Holzpaletten-Pyramide die Produktpalette, bestehend aus Möbeln und Accessoires für den Wohn- und Essbereich (etwa Sofa, Couchtisch, Teppich) und Mode-Kollektion, die er in Zusammenarbeit mit Adidas, Artek, Konstantin Grcic und anderen realisieren durfte. Außer mir ist niemand anwesend. Borries sitzt mit der Revolutionärin Slavia in limitierten (3 Stück) Kostas Murkudis Overalls davor, sie erklären die Shareholder-Revolution, den aktionistischen Ausgangspunkt. Ihre Füße stecken in schwarzen Adidas-Sneakern, die man nicht kaufen, sondern nur durch Protest erwerben kann, Borries trägt eine goldene Brille. Denn Gold, sagt er, ist Glamour. Ich kombiniere: Die Pyramide ist ein Symbol für Berlin. Der Schriftsteller Ingo Niermann wollte von hier aus das größte Grab der Welt in Pyramidenform bauen, man denke auch an die Bierpyramide, die Cyprien Gaillard vorletztes Jahr in die KW baute, und nun kommt Borries mit zwei gleichzeitig. Er nickt das ohne weiteres ab. Aber ich frage ihn: »Weltverbesserungsmaschine, was soll das? Geht es nicht dieser Tage eher um die Taktik der Selbstoptimierung? « »Oh«, verrät der Spitzbube, davor habe er persönlich große Angst.

Ich schaue auf meine neuen Nikes, von ihnen geht eine softe Melancholie aus. Die fast schwerelosen Shoes wirken beladen, mit unseren Sehnsüchten nach etwas Neuem, doch ein samtener Schleier abgenutzter Mode hat sich über das Obermaterial aus Polyestergewebe gelegt. Bunt sind sie, auch lassen sich Aztekenmuster darin erkennen, aber sie weisen nicht mehr in die Zukunft, sondern erinnern an etwas jüngst Verlorengegangenes. Sie bedeuteten so viel für uns: Post-Internet, Spekulativer Realismus, New Materialism – für uns ist das doch alles dasselbe, verschiedene Seiten einer einzigen Medaille. Künstliche Intelligenz, spiritistischer Glaubensgesang, die Überwindung der Retromanie und des Selbst. An ein Wir. Ich schaue ins Internet, Mail vom Marina Abramović Institute: »Will You Help?« Ich merke, dass es mir schwerfällt zu dieser Frage eine Haltung zu entwickeln. Ich denke an meinen Freund, der vor zwei Tagen zum paritätischen Dienst ging, er glaubte er sei verrückt. Mit einigen Fragen sollte dies direkt herausgefunden und ihm geholfen werden. An die zweite konnte er sich noch gut erinnern: »Haben sie manchmal das Gefühl sich aufzulösen?« Er hat kurz überlegt und nein geantwortet. Der August war heiß, so heiß wie in meiner ganzen Jugend vielleicht nur ein einziges Mal. Doch der kühlende Wind hat große Versprechen im Gepäck.
TIMO FELDHAUS lebt als freier Autor in Berlin.
