Seit mehreren Jahrzehnten dominieren Theorieströmungen auch den kunsttheoretischen Diskurs, die ihren Ursprung meist in den französischen 60er und 70er Jahren des vorigen Jahrhunderts haben. Seit einiger Zeit macht sich dagegen in England, den USA, Frankreich und dem Nahen Osten eine neue spekulative Bewegung bemerkbar, die zentrale Fragen der Philosophie, und zunehmend auch der Kunsttheorie, anders zu stellen versucht. Am Beginn dieser Serie steht freilich noch einmal ein französischer Theoretiker, QUENTIN MEILLASSOUX, der bereits mit seinen ersten Publikationen ein aufsehenerregendes Umdenken über das Wesen von Objekten, die Rolle der Wissenschaft und die Möglichkeit eines philosophischen Materialismus eingeläutet hat.
Einleitung von Armen Avanessian
Auch im Feld der Kunsttheorie zeigt sich die offensichtliche Verunsicherung zu einer akuraten Beschreibung des gesellschaftlichen Status quo zu kommen an immer feineren Ausdifferenzierungen von diversen post-, neo- und sonstigen -ismen, sowie immer subtiler werdender begrifflicher Binnendifferenzierung. In der letzten Dekade ist dagegen ein Begehren nach einer auch politischen Radikalisierung deutlich geworden, das sich vornehmlich an den Texten Jacques Rancières und Alain Badious orientierte, und deren deutlichstes Symptom wohl Slavoj Žižeks Aufstieg zum (Retro)Popstar der Theorie ist.
Diese Serie will nun jedoch überhaupt erst in den letzten Jahren hervorgetretene jüngere Autoren vorstellen. »Theorien für das 21. Jahrhundert« meint nämlich auch: Theorien aus dem 21. Jahrhundert, also Theoriemodelle, die sich nicht aus dem vorigen Jahrtausend hinübergerettet haben, sondern sich bereits in einer anderen, unseren heutigen, kulturellen Situation herausgebildet haben. Dass dieses Vorhaben ausgerechnet in einer englisch-deutschen Kunstzeitschrift verwirklicht wird, ist sicher auch den gegenwärtigen kulturellen Dominanzverhältnissen geschuldet. Denn wiederholt war es in der Vergangenheit so, dass innovative Theoriebildung erst über den Umweg der Kunstwelt (Zeitschriften, Theorieveranstaltungen, Katalogtexte, die nebenbei zahlreichen avancierten Theoretikern das außerakademische Überwintern sichern) einem breiteren Publikum zugänglich gemacht wurde, und sich erst am Ende dieses sich stets – und zuletzt auch immer schneller – wiederholenden Zyklus akademisch etablierte.

Seit ungefähr fünf Jahren findet eine Theorierichtung immer mehr Aufmerksamkeit, die zunächst unter dem Label »Spekulativer Realismus«1 hervorgetreten ist. Mit unterdezidiert rationalistisch und gleichzeitig mit geringen Berührungsängsten zu metaphysischen Fragestellungen, mit dem Anspruch auf neue Ontologien und dabei explizit realistisch bzw. materialistisch, zeichnen sich diese neuen Philosophen durch einen offensiv spekulativen Zug aus. Faszinierend haben besonders jene Gedankenexperimente gewirkt, die, wie im Falle Quentin Meillassouxs, gerne wissenschaftliche Erkenntnisse als philosophische Ressource nutzen. Die von Meillassoux imaginierten Gedankenexperimente zwingen uns, eine Welt vor und nach dem Menschen zu denken, und zwar im emphatischen Sinn eines Denkens des Absoluten. Es geht also darum, das uns absolut Unzugängliche zu denken: Dinge (archifossile) vor und nach jedem menschlichen, animalischen, pflanzlichen Leben; eine radikale Kontingenz (facticité); die Absenz jedes Grunds für die Realität (irraison); hyper-chaos.
Besonders an einer zentralen Begriffsschöpfung kann auch die Herausforderung für ästhetische Überlegungen, ja für Ästhetik und ihr Erfahrungsparadigma insgesamt, verdeutlicht werden. Seinen realistischen und materialistischen Ansatz formuliert Meillassoux nämlich im radikalen Gegensatz zum Korrelationismus aller bisherigen Philosophie. Korrelationismus meint dabei das Scheitern, Objekte, Dinge und Gegenstände unabhängig von der Korrespondenz zu einem sie denkenden oder wahrnehmenden Subjekt zu begreifen. Der Dualismus von Denken und Wahrnehmen, der das philosophische und kunsttheoretische Denken seit der Erfindung der Disziplin Ästhetik im 18. Jahrhundert prägte, wird von Meillassouxs spekulativem Materialismus also massiv in Frage gestellt. Und mit der Hinterfragung des Erfahrungsparadigmas von Ästhetik, der Fokussierung auf die Wahrnehmung (aisthesis) von Objekten, ergeben sich dann auch Fragen nach Alternativen zu dem, was Jacques Rancière bekanntermaßen als Ästhetisches Regime der Künste auf den Begriff gebracht hat.
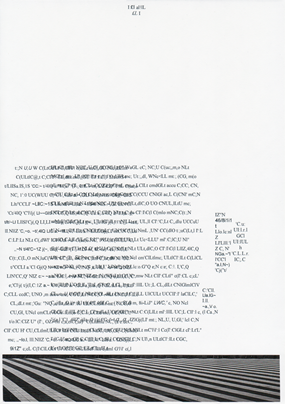
Ist das heute weiterhin dominante korrelationistische Denken vielleicht sogar ein Hindernis relevante Tendenzen in der zeitgenössischen Kunst zu verstehen, und was wären Beispiele für eine nicht-korrelationistische Kunst? Daran schließt sich die generelle Frage, ob sich andere und neue Verbindungen zwischen philosophischem Denken und künstlerischer Produktion herstellen lassen, als solche die theoretisch zwischen einem wahrnehmenden ästhetischen Subjekt und wahrgenommenen Kunstobjekten vermitteln. Und wie steht es um konkrete kunsttheoretische Strömungen, etwa aus dem Umkreis der relational aesthetics, angesichts der spekulativ realistischen Forderungen der Begegnung zwischen Subjekten und Objekten nicht mehr länger einen Vorrang vor derjenigen zwischen Objekten untereinander zu geben?
Das sind wohlgemerkt keine von Meillassoux selbstaufgeworfene Fragen, der sich bisher kaum zu Fragen zeitgenössischer Kunst geäußert hat. Aber es sind Fragen, die sich zwingend von seinem spekulativen Ansatz her ergeben, und die etwa in der nächsten Ausgabe in einem Round-Table-Gespräch mit Kunsttheoretikern, Philosophen und Künstlern diskutiert werden. Vorliegender Aufsatz soll dem Leser einen ersten Einstieg in das spekulative Universum des 21. Jahrhunderts ermöglichen. Quentin Meillassouxs Beitrag ist eine Erstpublikation und geht zurück auf einen am Londoner Goldsmith College gehaltenen Vortrag, in dem er Grundzüge seines 2006 erschienenen Buchs »Après la finitude: essai sur la nécessité de la contingence« erläutert und ausdifferenziert.
1 In Collapse (Volume III), der englischen Zeitschrift für Philosophical Research and Development, findet sich eine umfangreiche Transkription der Diskussionen im Kontext der namensgebenden Konferenz vom April 2007.
Der Philosoph und Literaturtheoretiker ARMEN AVANESSIAN gründete 2012 die Forschungsplattform »Spekulative Poetik« (WWW.SPEKULATIVE-POETIK.DE). Er unterrichtet Vergleichende Literaturwissenschaft an der Freien Universität Berlin und war 2011 bzw. 2012 Visiting Fellow an der Columbia University und Yale University. Letzte Veröffentlichungen sind unter anderem »Phänomenologie ironischen Geistes« (Wilhelm Fink, 2010), »Aesthetics and Contemporary Art« (Sternberg, 2011, mit Luke Skrebowski herausgegeben) und »Realismus Jetzt! Spekulative Philosophie und Metaphysik für das 21. Jahrhundert « (Merve, 2012). Er ist Gastredakteur der neuen Reihe »Theorien für das 21. Jahrhundert«. Er lebt in Berlin.
In der Printausgabe finden Sie den vollständigen Beitrag mit »Time without Becoming« von Quentin Meillassoux.
