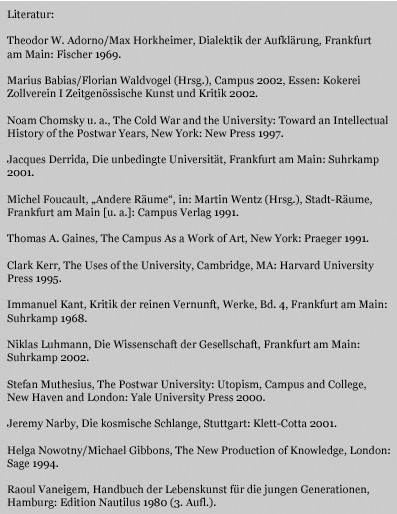ESSAY VON FLORIAN WALDVOGEL:
KNOWLEDGE WAS THE BEGINNING
Zum ersten Mal sollte ein internationales Kunst-Großevent in Form einer „experimentellen Kunstschule“ abgehalten werden. Florian Waldvogel, einer der Kuratoren der Manifesta (Nikosia, Zypern), über seine Vision einer m6school.
Oktober 1992
Vieles spricht für Kunsthochschulen, besonders für kleine. Wenn die Gesellschaft versagt hat, pubertierende Jugendliche davon abzuhalten, ihrer künstlerischen Berufung zu folgen, ist es besser, sie unter Ausschluss der Öffentlichkeit zusammenzustecken. Desorientiert und ohne jede Überzeugung, unschlüssig und träge: KunststudentInnen auf der Suche nach Street Credibility. Meine ersten Semester waren geprägt von Vorträgen und Bekanntschaften. Der erste Vortrag, den ich besuchte, war der von Ilya Kabakov, und ich verwechselte ihn mit Alan Kaprow, was in großen Kreisen der Professoren- und Studentenschaft Besorgnis auslöste. Die Oberschlauen, Anpassungsfähigen und Schnellschwätzer sind es doch, die vorankommen, dachte ich. Aber an solchen Spielchen beteiligt man sich nur, wenn man die Intelligenten in Verlegenheit bringen möchte, indem man Sachen diskutiert, von denen man eigentlich noch kaum etwas weiß. Intrigen und Eifersucht sind ganz gewöhnliche Kunstakademie-Eigenschaften, die wie Dialekt oder Alkoholismus von Generation zu Generation weitergegeben werden.
Ein Gemälde ist ein Spiegel, wenn ein Affe hineinsieht, so kann kein Apostel herausgucken
Der große Vorteil des Studiums an der Städelschule liegt bekanntlich in der Qualität der Ausbildung, die sie für die Studenten bereithält. Wir hatten alle eine anständige und breite hessische Erziehung im Ertränken unserer Vergangenheit erhalten, Probleme gab es aber dann, wenn die Gegenwart nicht schwimmen konnte. Das war nicht allein das Verdienst einiger Malerfürsten, obwohl manche von ihnen nicht davor zurückschreckten, uns praktische und künstlerische Tipps in Form von Spirituosen zu erteilen, die unser Boheme-Herz erfreuten. Einige von uns verkürzten sich damit die langen und dunklen Nächte des Spätkapitalismus. Den meisten von uns war der Freiraum gelassen worden, den eigenen künstlerischen Weg zu finden und die eigenen existenziellen Lektionen zu lernen. Freiheit zum Denken, zum Widerspruch und zur Veränderung. Ich wollte es mir nicht im frostigen Komfort meines eigenen Scheiterns und Verfalls bequem machen und war schnell zu der vielen einsamen KünstlerkollegInnen nie zuteil werdenden Erkenntnis gekommen: Aus mir wird nie ein Künstler. Wenn man ein Seminar der Selbstkritik erfinden würde, könnte auch für viele meiner KommilitonInnen die beste Zeit ihres Lebens beginnen. KunststudentInnen sind der Humus im Monumentalfilm der Kunstgeschichte.Mit all der tödlichen Entschlossenheit und humorlosen Konzentration eines Sportbegeisterten beschloss ich, mein Leben zu ändern. Ich wurde Assistent von Rektor Kasper König. Mein Leben hatte wieder einen Sinn, ich verbrachte glückliche Stunden beim Kopieren von Akten und machte wertvolle Erfahrungen beim alphabetischen Katalogisieren von Künstlerpublikationen.Nur wer einen Pinsel hat, kann sich die Zukunft ausmalenIm Sommer ’98 stand ich kurz vor dem Abschluss meines Studiums. Denn nur wer einen Pinsel hat, kann sich die Zukunft ausmalen, den Geist der Utopie atmen, in dem Wissen, dass wir die Welt eh nicht verändern können.
Marcel Duchamp erkannte schon früh, dass sich der/die KünstlerIn vom Rande der Gesellschaft in deren Zentrum bewegt. Für Duchamp sind KünstlerInnen in hohem Maße in die Gesellschaft integriert, sodass sie nach ihrer Emanzipation von Auftragsarbeiten und Mäzenatentum geradezu verpflichtet sind, die Weiter- und Ausbildung ihres Intellekts zu betreiben. Duchamp beanspruchte zu Recht, mehr zu sein als ein Schwätzer und Räuber in Latzhosen, weil er sich mit einer Gesellschaft konfrontiert sah, die der Verwertungslogik des Kapitalismus gehorchte und deshalb in einer intellektuellen Obdachlosigkeit lebte.
Bisher gilt doch für die meisten ProfessorInnen an Kunsthochschulen: dienstlich unauffällig altern und mehr verdienen. Dabei spielt es keine Rolle, ob die ProfessorInnen als internationale Kapazitäten gelten oder als akademische Tiefflieger. Die pädagogische Eignung von KunsthochschulprofessorInnen wird nach wie vor einfach vorausgesetzt, Karriere machen sie ausschließlich mit Erfolgen im Kunstbetrieb.
Bataille, Derrida und Kant
Wenn unser Blick auf die Gesellschaft, auf ihre sozialpolitischen Veränderungen begrenzt ist, dann ist es auch unser Blick auf die Kunst. Georges Bataille hat die Kunst als eine Handlung definiert, die ihrem Wesen nach kontrovers ist und sich im Widerstand zum Bestehenden befindet. Wenn man diesem Kunstbegriff zustimmt, wie kann Kunst dann gelehrt werden? Jacques Derrida sieht in der Hochschule eine dissidente, widerständige, kritische und dekonstruktive „Opposition zur Staatsmacht, zu ökonomischen Mächten, zu medialen, ideologischen, religiösen und kulturellen Mächten, welche die kommende und im Kommen bleibende Demokratie einschränken“. Die Universität soll daher auch ein posthierarchischer Raum sein, eine „université sans condition“, eine „Universität ohne Rang und Status“. Derridas Lehranstalt ist ein „privilegierter Ort der Widerstandskraft und der Dissidenz“, weshalb ihr die unbedingte Freiheit zukommt. Auch für Immanuel Kant war die Universität eine „öffentliche Anstalt“, die den Auftrag der Kultivierung „aller Wissenschaften“ und ihrer „Verwahrung gegen Beeinträchtigungen“ übernommen hatte. Universitas bedeutet „das Ganze“ oder „die Welt“, und die Universität verkörpert den Charakter der Einheit und Ganzheit. Und was für eine Universität gilt, gilt erst recht für eine Kunsthochschule. An Kant und Derrida anknüpfend, rückt eine gesellschaftspolitisch brisante Frage in den Vordergrund: die Bildungspolitik. Die Bedeutung der Hochschule als gesellschaftlicher Ort wird in Zukunft kaum geringer werden. Schulen und Universitäten verlieren zunehmend ihre einstige gesellschaftspolitische Autonomie, sie werden zu Orten der beruflichen Qualifizierung. In einer solchen Situation wächst Kultureinrichtungen ein neues Aufgabengebiet zu, nämlich Modelle der Ausbildung zu erproben, die nicht ausschließlich der Berufsqualifizierung dienen. Da sie traditionell schneller und flexibler auf gesellschaftliche Entwicklungen reagieren, könnten sie Ausbildungsmodelle von morgen entwickeln.
m6school
September 2006. In meiner Vorstellung ist die m6school eine Ausstellung oder ein Projekt, bei dem das allgemeine institutionelle Elend und die marktübliche ästhetische Einbalsamierung nicht stattfinden. Es handelt sich um den Versuch, einem optimismusverseuchten Kulturbetrieb, der einer redundanten Bildideologie huldigt, eine Form von institutionskritischer Praxis und ein anderes Modell des Sehens, des Denkens und des Handelns entgegenzusetzen. Es geht mir grundsätzlich um die Frage der „Education“, der Ausbildung und Wissensproduktion, als Ausstellungsformat, um Diskussionen, Seminare, Workshops als Praxisform und um deren Vermittlungsdisplays. Meine m6school diskutiert, wie Menschen innerhalb ihrer lebensbestimmenden politischen und ökonomischen Strukturen kulturelle Spielräume für individuelles Handeln finden. Und wie diese genutzt werden können. Es geht darum, die kulturellen Mechanismen und Strukturen zu untersuchen, die solches Handeln begünstigen, es fördern oder es einschränken. Und gleichzeitig geht es darum, wie in konkreten politischen Machtverhältnissen Realitäten und ihre Wirkungsweisen konstruiert und dann gelebt werden.
„Campus“, Radio, Bibliothek
Braucht die m6school überhaupt ein Gebäude, einen Ort? Ein Campus hat einen ambivalenten Charakter, hier werden lokale Gegebenheiten mit universellen Aufgaben verknüpft. Der Ort an sich spielt keine Rolle, wenn die Welt zum Forschungsgegenstand erklärt wird. Dem entspricht, dass das gesamte Kursmaterial online zugänglich gemacht wird. Die Schule ist „wireless enabled“, und die StudentInnen werden so überall arbeiten können, auf dem Rasen, im Café, zu Hause. Das Ideal der m6school als Ort spontanen und beiläufigen Lernens, des Schlenderns und des Austauschs soll die lokale und internationale Gemeinschaft der Hochschule im virtuellen Raum unmittelbarer als bisher vernetzen.
Ein weiteres auf Wissen basierendes Vermittlungsmodell, ein englischsprachiger Satelliten-Radiosender, kann weltweit empfangen werden. m6school-radio ist ein transdisziplinäres und demokratisches Kommunikationsmedium, das verschiedenste Redeformen, Kontexte und ästhetische Verfahren ineinander blendet und so diskursive Hörerlebnisse als neue Form der Wissensvermittlung kreiert. Theorie- und Wissensbildung werden als kontinuierliche Praxis mit der affektstimulierenden Kraft einer ausdifferenzierten und avancierten Popkultur in ein Spannungsverhältnis gesetzt. Dieses Radioformat wird sowohl eine Fülle unterschiedlich aufbereiteter (Interviews, Reportagen, Musikfeatures, Jingles, Soundskulpturen ...) Themen wie auch eine unmittelbare Involvierung und Aktivierung der vor Ort befindlichen Hörerschaft ermöglichen.
Das Gravitationszentrum der m6school ist die Online-Bibliothek als Ort der Forschung, der Akkumulation und der Organisation von Wissen, des weltweiten Informationsflusses und der globalen Vernetzung. Sie ist rund um die Uhr geöffnet. Sie ist eine Bibliothek ohne Mauern, deren Ideologie dem Wissen, der Dynamik der Vernetzung geschuldet ist. Diese Bibliothek dient in erster Linie ihren Besuchern und nicht den Büchern.
Schluss
In Anknüpfung an Vorstellungen, die im Manifest des Kollegiums des Collège de France (1987) über das „Bildungswesen der Zukunft“ formuliert wurden, ist eines der übergeordneten Ziele dieses Projekts die Überwindung von historisch überkommenen, disziplinären Beschränkungen in der Beschäftigung mit Kunst.
Meine m6school will die Grenzen der einzelnen Felder von wissenschaftlichen, künstlerischen, kulturellen und politischen Praktiken produktiv überschreiten, im Sinne der Verbindung ihrer verschiedenen Kontexte.
An den meisten Kunsthochschulen erfolgt die Ausbildung zum/zur KünstlerIn ganz selbstverständlich ohne die Reflexion von Gesellschaft. Die längst notwendige Korrektur besteht darin, den Schwerpunkt nicht auf die selektiven Qualitätskriterien der Hochkultur zu richten, sondern das nicht mehr adäquate Bild der KünstlerInnen zu korrigieren, das realitätsfremd im Schutzraum der Akademie konserviert wird. Es kann angesichts veränderter gesellschaftlicher Aufgaben nicht mehr länger darum gehen, dieses stereotype Künstler-Bild weiter zu reproduzieren oder es bei der Einführung neuer Technologien zu belassen. Die klassischen akademischen Disziplinen und Klassen müssen aufgelöst werden. Die Aufhebung von tradierten Vermittlungs- und Ausbildungsformen ist für eine zeitgenössische „Education“ an einer europäischen Kunsthochschule von existenzieller Bedeutung. Heutige Kunsthochschulen müssen gesellschaftliche Entwicklungsprozesse reflektieren, denn ohne sie kommen sie auf keinen Begriff ihrer selbst und ihrer zu verhandelnden inhaltlichen Gegenstände.
FLORIAN WALDVOGEL lebt in Frankfurt am Main.