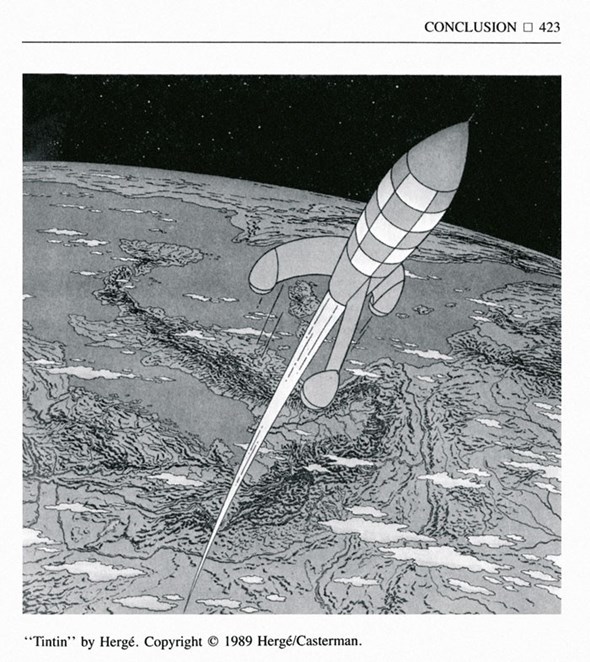
MAI-THU PERRET
Klaus Theweleits »Männerphantasien«
Christian Egger: Zwei Fragen zu Beginn: Wann bist du auf Klaus Theweleits »Männerphantasien« zum ersten Mal aufmerksam geworden, und was war dein Eindruck?
Mai-Thu Perret: Vor ein paar Jahren besuchte mich meine Freundin Carissa Rodriguez in Berlin und erzählte mir von diesem Buch. Es klang interessant, und dass ich zu der Zeit in Deutschland lebte, war auch ein Anreiz. Da mein Deutsch nicht sonderlich gut ist, bestellte ich mir die englische Ausgabe im Internet. Was mir als Erstes auffiel, war dieser ungewöhnliche Stil, dieser Mix aus einem sehr persönlichen, sehr leidenschaftlichen Ton und einer genauen Lektüre der Textquellen. Das Nächste war die originelle Verwendung von Bildern. Es gibt eine Art Parallelerzählung, die durch Theweleits intelligente und humorvolle Auswahl der Illustrationen entsteht. Es sind in den seltensten Fällen bloße Illustrationen im traditionellen Sinn. Sehr oft sind sie überhaupt nicht von der Zeitperiode her auf den Text abgestimmt, sondern eher das Resultat eines assoziativen Denkens auf der Suche nach Bildern, die auf eine sehr idiosynkratische Weise als Kontrapunkt zum Text agieren. Es ist clever, eine Picabia-Zeichnung eines nackten Frauenkörpers von hinten, vom Wort »Literatur« umflossen wie von Wasser, zu verwenden oder einen Robert-Crumb-Comic, um ein Buch über die Angst vor dem Weiblichen der deutschen Freikorps-Soldaten der frühen 1920er Jahre zu illustrieren. Das bringt das sehr spezielle Material des Buches und seinen Brennpunkt mit weitreichenderen und aktuelleren Anliegen (die neue deutsche Linke, die antiautoritären Bewegungen der 1970er Jahre) in Berührung.
Text scheint eine wichtige Rolle in deiner Arbeit zu spielen. Was findest du nach wie vor nützlich an Theweleits unakademischem und damals bahnbrechendem Zugang seiner akribischen Studien zur Beziehung zwischen Frauenfeindlichkeit und Faschismus, die er in den Besonderheiten von Zeit, Ort, Kultur und sozialer Herkunft (Körper, Geschlecht, psychoanalytische Theorie berücksichtigend) verortet?
Das Interessanteste an Theweleit ist, dass er es schafft, zwei Fallen akademischen Schreibens zu entgehen: Zum einen handelt es sich hier nicht um »Theorie«, das Buch ist extrem empirisch und weigert sich, männliche Gewalt und Dominanz als universelles und monolithisches Ding zu sehen. Zum anderen ist es nicht einfach eine historische Studie, sein Material hat ganz offensichtlich einige Relevanz für die aktuelle Mann-Frau-Beziehung. Der unbewusste Zusammenhang zwischen der Haltung des Freikorps und den zivilisierteren Formen der Misogynie der 1970er (oder auch zu anderen Zeiten im 20. Jahrhundert, wenn wir schon dabei sind) wird einem dadurch nähergebracht, dass die Bilder sich weigern, ausschließlich den Text zu illustrieren, und in ein freies, assoziatives Muster überfließen, das das Damals mit dem Jetzt verbindet. Natürlich kann man sagen, dass Theweleits Buch Makel hat. Da gibt es zum Beispiel Passagen über die Vergangenheit des Menschen als amphibische Gattung, die ich während der Lektüre stark anzweifelte. Aber das Wichtigste daran ist, dass es genau dieses Risiko auf sich nimmt, fehlerhaft und militant zu sein. Indem Theweleit einen so detaillierten, soziologisch fundierten Bericht über männliche Gewalt im Freikorps schildert, zeigt er auch Wege zur Überwindung solcher Gewalt, im Leben eines jeden. Theweleit weigert sich, Gewalt als Symptom von etwas anderem zu lesen, sondern er will sie als das, was sie ist, angegangen wissen. Diese Wörtlichkeit ist äußerst bestärkend und erinnert mich an das, was ich bei Deleuze und Guattari am meisten schätze, deren Einfluss auf das Buch sehr spürbar ist. Was die Frage der Beziehung zwischen dieser Art Text und meiner Arbeit anbelangt, bin ich mir nicht sicher. Gewissermaßen weigere ich mich auch, ein Ding als/für etwas anderes zu lesen, und ein Großteil meiner Lektüre hat nur wenig mit meiner Arbeit direkt zu tun. Ich mag es, um des Lesens willen zu lesen, und jedes Buch, das ich mag, mag ich ungeachtet eines unmittelbaren Nutzens für meine Arbeit. Aber genauso gut könnte man jetzt sagen, dass genau dieses Lesen um des Lesens willen erklärt, warum in meine Arbeit so viel Text einfließt.
Bei meiner Ausgabe ist auf dem Umschlag Bruce Naumans »Marching Man« abgebildet. Was sieht man auf deiner Ausgabe? Wäre »Marching Man« auf »The Crystal Frontier« willkommen? Wie würdest du dein Projekt »The Crystal Frontier« jemandem erklären, der noch nie davon gehört hat?
Meine Ausgabe ist eine Übersetzung der University of Minnesota Press, aus der Reihe »Theory out of Bounds«. Am auffallendsten ist die verwendete Schrift, eine eher krude Gothic-Schrift, wo die Spitze des dolchförmigen »f« von »fantasies« mit Rot überzogen ist, als ob’s Blut wäre, also nicht wirklich subtil. Und dann gibt es ein eher rätselhaftes Bild von Stiefeln, auch schwarz mit einem roten Lichtschleier dahinter. Es ist von einer Künstlerin namens Mary Griep, von der ich noch nie gehört habe. Nach »Marching Man« musste ich googeln, es ist eine Neonarbeit, die einen cartoonhaften Mann im Marschschritt zeigt; der Penis grell erregt. Ich denke nicht, dass er von den Figuren von »Crystal Frontier« sehr gemocht werden würde. »The Crystal Frontier« ist der Name einer fiktiven autonomen Community, die der vermeintliche Schöpfer oder Referent der Kunstwerke, die ich produziere, ist. Es handelt sich dabei um eine Gruppe von Frauen, die weit ab von der Stadt und einer modernen, kapitalistischen Gesellschaft in der Wüste lebt und die versucht, vollkommen von vorne anzufangen und eine neue Beziehung zur Arbeit, zur Natur und zu sich selbst aufzubauen. Die Geschichte ist durch diskontinuierliche Textfragmente wie Tagebucheinträge, Briefe, Flyer etc. nur vage umrissen. Ich begann die Arbeit der Kommunenmitglieder, weil ich auf der Suche nach einer Möglichkeit war, mich selbst, die unausweichliche Tendenz zu autobiografischen Spuren und persönlichem Geschmack, aus meiner Arbeit herauszunehmen. Am Anfang war es ein Weg, mit fixen Parametern zu arbeiten, um dann zu sehen, was daraus entstehen würde. Ein wenig wie in der Konzeptkunst, wenn Sol LeWitt sagt: »Die Idee ist die Maschine, die die Kunst produziert«, dabei aber eine komplexere fiktionale Maschine zu verwenden. Seitdem hat sich das Projekt in viele unerwartete Richtungen entwickelt.
Im Nachwort meiner Taschenbuchausgabe meint Theweleit, dass der Autor auf telepathische Weise wisse, wie seine Anliegen beim Leser aufgenommen würden, und dass daher der Rest unbeleuchtet bleiben könne (und er deshalb auch keine Leserpost beantworte). Etwas, dem du zustimmen würdest, auch in Bezug auf (deine) Kunst? Und wie gehst du mit Autorenschaft allgemein um?
Also wenn ich das richtig verstehe, fragst du mich über das Verhältnis des Urhebers zu seinem Werk, nachdem es abgeschlossen und anderen zugänglich ist. Ich bin keine Theweleit-Expertin, ich habe nur dieses Buch gelesen und weiß nichts von seiner Weigerung, Leserbriefe zu beantworten. Ich wäre hier nicht so rigoros (andererseits werde ich wohl nie so viel Briefe bekommen wie er, das Buch muss bei seinem Erscheinen sehr polemisch gewesen sein). Im Allgemeinen mag ich es nicht, das Verständnis eines Werkes zu stark zu determinieren. Die Erzählung, die ich als Erklärung meiner Arbeit anbiete, ist so dünn und zeitweise bizarr, dass sie unmöglich als einzige Interpretation meiner Arbeit funktioniert. Es ist ein spezielles Werkzeug dafür, die Arbeit zu machen und darüber nachzudenken. Aber die Arbeit ist sicher nicht eindeutig. Wenn man sich eine bestimmte Arbeit ansieht, fügen sich weitere Dinge zur Erzählung der Kommune hinzu, etwa historische Bezüge. Und diese Offenheit ist es, die mich interessiert.
Theweleit: »Machart und Aufbau des Buches sind […] explizit unphilosophisch, um nicht zu sagen antiphilosophisch. Nirgendwo (außer in der Mathematik und der religiösen Scholastik) hat sich das Knochengerüst männlicher Begrifflichkeiten derart hart und abweisend manifestiert wie in den philosophischen Schulen von der Antike bis zu Adorno […] Was ›Männerphantasien‹ entwickeln wollte, war zuallererst ein anderer Ton.«

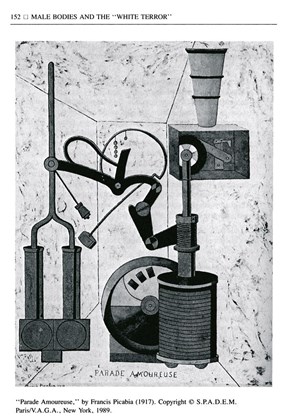
Könnte es sein, dass es dir mit deinem investigativen Zugang zu Kunst und dem Zitieren von Ästhetizismen der Moderne sowie diversen 20.-Jahrhundert-Referenzen um eine andere Blickweise geht?
Interessant, dass du diese Frage stellst. Wenn überhaupt, dann ist mein Gebrauch modernistischer Bilder und Referenzen ein revisionistischer Zugang zur Kunstgeschichte. Wenn man sich ein bisschen Zeit nimmt, über Modernismus zu lesen, dann beginnt seine gängige Konstruktion als eine als rationale, fortschrittsgebundene, männlich dominierte Anstrengung sich in eine Myriade unterschiedlicher Sichtweisen zu zerstückeln, mit unzähligen minoritären Figuren und vergessenen Stimmen. Mich interessiert der nicht eingeschlagene Weg, die Gestalt, die Dinge nicht angenommen haben, die sie aber hätten annehmen können, und ich denke, es ist dieser Geist, vor dessen Hintergrund ich Bilder der Vergangenheit betrachte. Theweleit spricht über etwas komplett anderes, über die philosophische Tradition, die eine akademische ist und als solche viel autoritärer als die Kunst, die ich betrachte.
Du hast erwähnt, eine unkonzentrierte Leserin zu sein, die mehrere Bücher gleichzeitig liest. Glaubst du, das ist der Grund, warum kein Buch sich heute schnell als Kunsttheorieklassiker durchsetzt, weil viele der KollegInnen ähnlich lesen/arbeiten? Oder nimmst du an, dass das ohnehin immer schon so war?
Vermutlich ist es richtig, dass – anders als in den 1960ern, 1970ern und sogar 1980ern – wir uns in einer pluralistischeren und weniger interessanten Zeit für Philosophie oder »Theorie« befinden. Ich bin mir nicht sicher, ob das etwas ist, worüber man traurig sein muss. Dinge kommen und gehen in Zyklen, und gerade dann, wenn Leute sich einmal mehr über ein Tief beklagen, bahnt sich wieder etwas Erstaunliches an, das unsere Sichtweise verändert. Aber in den letzten fünf Jahren gab es kein Buch, das als Referenz dafür diente, über Kunst zu sprechen, so wie zum Beispiel Jean Baudrillard für die Kunstwelt der 1980er Jahre wichtig gewesen war. Nicht dass ich glaube, dass Baudrillard so großartig wäre; darum bin ich mir auch nicht sicher, ob wir da überhaupt viel versäumen, wenn wir zurzeit keine große Kunsttheoriemode haben. Das andere ist, dass Leute in verschiedenen Lebensabschnitten unterschiedlich lesen. Ich habe Philosophie und Literatur studiert, wo ich lernen musste, Bücher vom Anfang bis zum Ende zu lesen. Ich kann mich sogar erinnern, dass ich versucht habe, Bücher dadurch zu verstehen, dass ich so präzise Anmerkungen machte, dass sie sinnlos wurden und ungefähr gleich lang wie die Bücher selbst. Irgendwann beginnt man, andere Dinge zu unternehmen, als in der Bibliothek zu sitzen, und man wird ein bisschen salopper in seiner Einstellung zum Lesen. Ich lese immer noch eine Menge Belletristik, und ich lese Romane immer von Anfang bis Ende. Es gibt auch Bücher, wo es okay ist, sie in einer loseren Weise zu lesen, und man kann sich dennoch für seine persönliche Werkzeugkiste etwas mitnehmen.
Vielleicht ist es fürchterlich zu fragen, aber wenn »The Crystal Frontier« ausschließlich als Buch existieren würde, was wären dann die signifikantesten Unterschiede im Vergleich zu den anderen Werken, und welche Mängel wären am offensichtlichsten?
Ich glaube nicht, dass es als Buch allein funktionieren würde. Es wäre sehr kurz und eher langweilig zu lesen, weil ihm jeder Sinn für narrative Entwicklung fehlen würde. Vielleicht könnten es knapp komponierte Gedichte sein. Aber es sind die Kunstwerke, die erst eine Existenz als zeitlose Fragmente ermöglichen.
Aus dem Englischen von Christian Egger
KLAUS THEWELEIT »Männerphantasien 1 + 2«, Piper, Müchen 2002
CHRISTIAN EGGER ist Künstler und lebt in Wien.
MAI-THU PERRET * 1976 in Genf. Unter den jüngsten Einzelausstellungen sind u.a. “And Every Woman Will Be a Walking Synthesis of the Universe”, The Renaissance Society, Chicago (2006), “Apocalypse Ballet” Galerie Barbara Weiss, Berlin (2006), “Solid Objects” (mit Valentin Carron), Centre d'art contemporain, Genf (2005). Seit 1999 schreibt sie an Fragmenten für “The Christal Frontier”, einem fiktiven Bericht über eine Gruppe von Frauen, die eine autonome Kommune in der Wüste gründen. Parallel zum Text werden Arbeiten als hypothetische Kunstwerke der Frauen geschaffen und ausgestellt. Sie lebt in Genf und New York.
